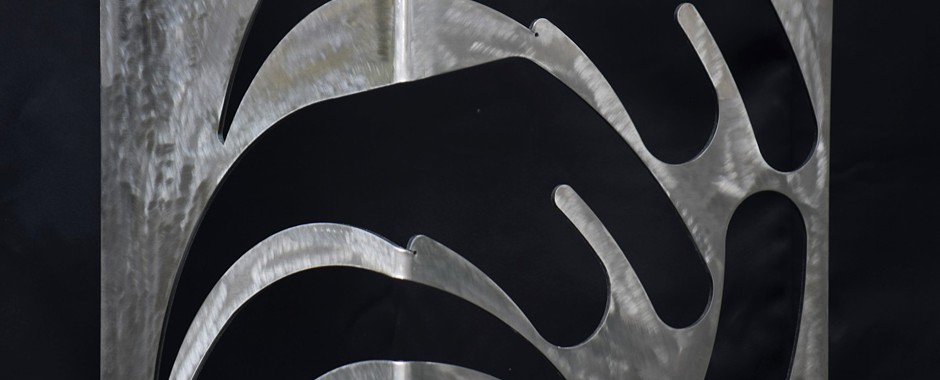
The Universal Soldier
Stahl, mehrteilig, gelasert, gebogen im Winkel von ca. 65°; roh geschliffen, klar gelack. Basis: Stahl, trapezförmig, farbig gelackt, Struktureffektlack. 160 x 70 x 60 cm.
Inventarnr. Digicult BG00010
"Irgendwo ist immer Krieg. Irgendwo gibt es immer Konflikte: inner- oder zwischenstaatliche Kriege, Auseinandersetzungen mit sporadischem oder wiederholtem Gewalteinsatz. Irgendwo gibt es immer Krisen: sei es um Vorherrschaft, Macht oder Autonomieansprüchen, sei es um Ressourcen, ideologische oder systemstrukturelle Differenzen. " Berthold Grzywatz.
BERTHOLD GRZYWATZ
Stille legt sich
Auf betroffene Pflanzen,
In rostigen Dosen
Reste von Wasser,
Trockene Lippen probieren
Geduldiges Blech;
Schmutzige Hände ertasten
Die Linien des Schmerzes
Unter dem Olivgrün;
Wissende Augen
Verirren sich im Luftraum;
Im Dunst des Blaus
Verliert sich jeder Halt –
Verständnis für Fragen
Scheitern
Am fehlenden Netz –
Im Innern
Eines nutzlosen Dieners
Bersten Dämme –
Die Schreie,
Von niemandem gehört,
Entfliehen
In das Irgendwo –
Der gemeine Soldat hat Angst.
Tage
Für den Umsturz,
Die Unabhängigkeit,
Die Verfassung,
Den Geburtstag eines Helden,
Zeremonien
Für den Abschied eines Präsidenten,
Den Empfang eines Würdenträgers,
Für das Gedenken an Opfer
Und Aufrechte
Spiegeln sich im Glanz
Gestärkter Uniformen,
Präsentierter Waffen,
Polierter Stiefel;
Die unvermeidliche Musik
Sorgt für Rührung,
Für ein Band der Gewissheit
Berufen zu sein –
Im Innern
Gedrillter Marionetten
Herrscht Aufruhr –
Die Gedanken,
Von niemandem geteilt,
Zerbrechen
An eingeübten Gerüsten –
Der gemeine Soldat hat Angst.
Die Sterne haben sich
Zum Fernbleiben entschlossen –
In der Dunkelheit
Suchen die Hände Schutz
Auf geöltem Stahl;
Das Herz fragt sich,
Ob es zum Einsatz kommt;
Die Ohren trauen sich nicht,
Dinge zu ordnen;
Das Zittern lässt
Eine unerwartete Kälte vermuten –
Im Innern
Ohnmächtiger Rekruten
Zieht Leere ein –
Die Antwort,
Von niemandem geteilt,
Findet sich
Im unbändigen Entladen
Der Magazine –
Es ist nur eine Übung –
Doch:
Der gemeine Soldat hat Angst.
Im geschlossenen Geviert,
Der überschaubaren Organisation
Planvoll gestaffelter Gebäude
Verbinden sich taube Hände
Zu einem Reigen
Des Füreinander;
Der plötzliche Fortgang
Eines Einzelnen
Fordert die Vorsteher heraus,
Das normierte Abschreiten
Des Alltags
Kennt keine Lücken,
Unerwartetes
Muss dem Appell weichen,
Das Ornament der Ungezählten
Sichert Ruhe –
Im Innern
Engherzig Gebildeter
Naht eine Krise –
Die Gefühle,
Von niemandem geteilt,
Proben sich
Im Verdunkeln,
Im Namenlos sein –
Und doch:
Der gemeine Soldat hat Angst.
Geschrieben Juni - 2017/überarbeitet Dezember - 2019/veröffentlicht in: Berthold Grzywatz,
Das unwirtliche Wirkliche. Gedichte, Aachen 2020.




